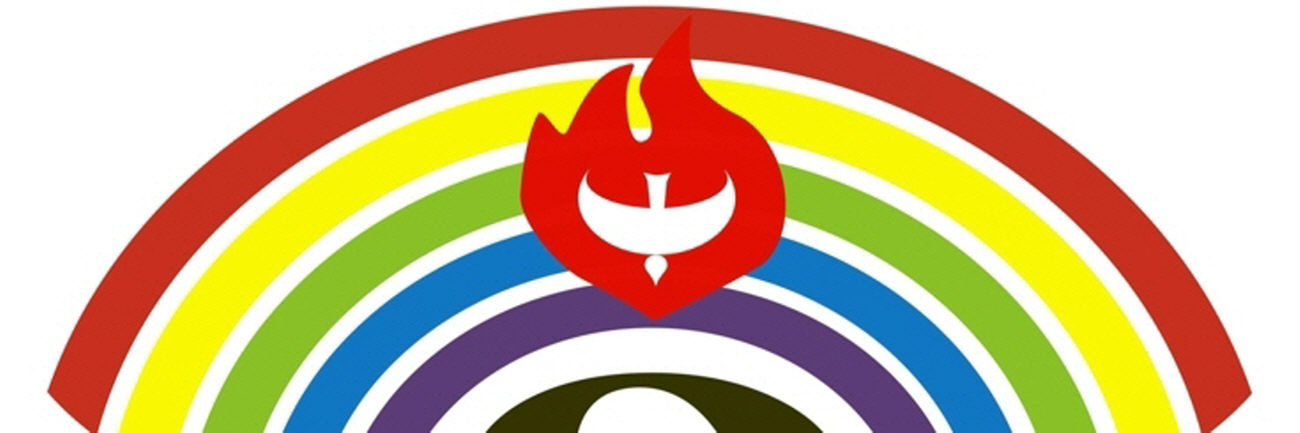Geistliches Üben
Grundgedanken zum geistlichen Üben
Das geistliche Üben ist eine in wesentlichen Punkten andere Weise, unbekannte Werke einzuüben, als weithin gelehrt und praktiziert wird.
Im geistlichen Üben von musikalischer Literatur stellen wir uns, unsere Gaben und Aufgaben in den Dienst Gottes. Wir sind damit Teil einer dreifachen Inspirationskette: Gott inspiriert den/die Komponisten/-in und uns, die wir das jeweils konkrete Werk immer wieder neu ins Leben rufen. Oder, um es in einem Bild zu formulieren: Die Komposition ist ein buntes Glasfenster, das von uns als Lichtquelle zum Leuchten gebracht wird, wobei wir als Lichtquelle die dafür erforderliche Energie aus Gott beziehen können, dürfen und sollen. Da jede Künstlerpersönlichkeit zu jeder Zeit eine immer wieder geringfügig andere "Lichtfarbe" erzeugt - abhängig von Persönlichkeit, emotionalem und geistlichem Zustand u.v.a - , wird dasselbe Glasfenster nie zweimal genau gleich leuchten - das Wesen von Kunst, die lebt.
Die drei Inspirationen
Künstlerisches Schaffen wird durch Kreativität ermöglicht, welche wiederum durch Inspiration lebt.
Beim Erarbeiten von Kompositionen dürfen wir drei Inspirationen, welche allesamt in Gott wurzeln, verbinden: Die des Komponisten, des Instrumentenbauers und unsere eigene, interpretatorische.
Als Interpreten sind wir das letzte Glied in der Kette und als solches gefordert, mit viel Einfühlungsvermögen und Hintergrundwissen die vorzufindenen Inspirationen des Werkes und des Instruments zu erfassen und unsere eigene Inspiration in deren Dienst zu stellen. Das geschieht dabei auf Augenhöhe, denn ohne unsere inspirierte und inspirierende Übersetzung in ein einmaliges, konkretes Klangerlebnis bleiben die beiden anderen Inspirationen stumm und irrelevant.
Ansätze für geistliches Üben
Auch das geistliche Üben geschieht nicht im luftleeren Raum. Es kann so geitlich und inispiriert sein, wie es mag: An neurologischen und psychologischen Fakten kommt man ebensowenig vorbei wie an der Erfordernis von Disziplin.
Die folgenden Gedanken ersetzen auch kein individuelles Coaching, wie wir es in der Asaf-Akademie anbieten, sondern sollen einladen, erste Versuche selbt zu unternehmen.
1. Betende Grundhaltung
Asaf und seine Brüder werden im Alten Testament (2. Chronik 29, 30) als "prophetische Männer" oder "Seher" bezeichnet. Sie verfügten offensichtlich, salopp gesagt, über einen sehr "kurzen Draht" zu Gott. wenn wir uns in deren Nachfolge stellen wollen, ist es unumgänglich, unser Musizieren als "Kanal" für göttlich Inspiration aufzufassen und entsprechend mit einzuüben. "Betende Grundhaltung" bedeutet hier also nicht, Gott beim Üben zuzutexten, sondern sich zu öffnen für seine Offenbarung und Erkenntnis und für das Strömen des Heiligen Geistes durch unseren Körper.
2. Intensität statt Tempo
Wir arbeiten mit der Ewigkeit als Quelle. Unser Üben ist daher zunächst einmal jeglichem Zeitdruck entzogen. Als Tasteninstrumentalist sage ich: Wir spüren die Tasten, die Bewegungen, die Verbindungen von Tönen und Akkorden und lassen Gottes Energie vom Kopf durch unsere Gliedmaßen (Hände, Füße...) ins Instrument fließen. Jede noch so kleine Bewegung ist ein geistliches, ein heiliges Ereignis.
3. platonisches Kennenlernen vor Körperlichkeit
Was im normalen Leben eigentlich selbstverständlich ist bzw. sein sollte, kommt aufgrund meist fremdbestimmten Zeitdrucks oft zu kurz: Man "schafft sich das Stück drauf", um es möglichst schnell "ablassen" zu können. Das kann es nicht sein. Zu lieblos, zu erkenntnisarm bleibt das Erlebte und Weitergegebene.
An erster Stelle steht das Kennenlernen des Notentextes, was zumindest teilweise auch einer zumindest strukturellen Analyse nahekommt. So offenbaren sich Strukturen, Ähnlichkeiten, Steigerungen etc., die eine sinnvoll strukturierte Herangehensweise erst ermöglichen.
4. Pausen
Das Gehirn lernt durch Wiederholung, nicht durch Marathonsitzungen. Es ist besser, mehrmals am Tag eine halbe Stunde zu üben, als zwei oder vier Stunden am Stück. Auch die Beschäftigung mit dem Werk ohne Instrument ist hilfreich!
5. Perfektion ist kein Kriterium
Perfekt sein zu wollen, ist unmenschlich. Fehler sind nicht schön, aber egal. Kein Mensch macht gerne fehler, Musiker(innen) auch nicht. Sie passieren aber meistens unter dem Druck, fehlerlos sein zu müssen. Deswegen: Wo sich unser Musizieren ausschließlich zwischen uns und Gott abspielt, haben solch gnadenlose Maßstäbe keinen Raum und sind völlig bedeutungslos. Ein in der jeweiligen Situatioin höchstmögliches Maß an Perfektion stellt sich letztlich von selbst ein, als Nebenprodukt des Vorausgegangenen.
6. Lassen Sie sich Zeit, dann geht es schneller.